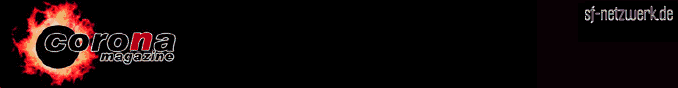Liebe Leserinnen und Leser des Corona Magazines,
heute melden wir uns mit der angekündigten letzten Sonderausgabe in diesem Jahr, von der wir bei der Ankündigung noch nicht wussten, dass es auch einen traurigen Anlass für den Versand geben würde. Die Frau des großen Vogels der Galaxis verstarb am vergangenen Donnerstag. Majel Barret-Roddenberry wurde 76 Jahre alt. Mehr dazu in dieser Sonderausgabe, in der wir Ihnen noch eine weitere SF-Serie ans Herz legen. Eine SF-Serie, die mich vor 28 Jahren zur Sciencefiction holte, wo ich dann mein Herz an "Star Trek" verlor. Naja, wo die Liebe hinfällt. Jene Serie ist heute auf alle Fälle genauso aktuell und gut wie damals, und evtl. wissen Sie bereits, welches Universum ich meine...
Dann haben wir noch zwei literarische Highlights für Sie: Eine Weihnachtsgeschichte unserer Kurzgeschichtenredaktion und alle bisher erschienen Kapitel unseres Corona-Fortsetzungsromans aus der Feder von Carolina Möbis. So haben auch die Leser unter Ihnen, die sich bislang nicht für die einzelnen Kapitel interessierten, die Gelegenheit, sich zur Weihnachtszeit noch einmal so richtig in "Die Memmen der Meere" einzulesen - und bis zum 31.12.2008 an der Abstimmung auf unserer Webseite teilzunehmen.
Eine gesegnete Weihnacht - wir lesen uns im nächsten Jahr!
Herzlichst
Mike Hillenbrand
Inhalt
Majel Barret-Roddenberry verstorben
Some kind of "Star Trek": Mark Brandis - die Hörspiele
Die Memmen des Meeres - the story so far
Die Corona-Kurzgeschichte
Majel Barret-Roddenberry verstorben
Majel Barrett-Roddenberry, die Witwe des "Star Trek"-Schöpfers Gene Roddenberry, ist am 18. Dezember im Alter von 76 Jahren in Bel-Air an Leukämie gestorben. Sie spielte im "Star Trek"-Pilotfilm "The Cage" den Ersten Offizier "Number One", in der "Star Trek"-Classic-Serie und den Kinofilmen Christine Chapel und in der Serie "Star Trek: The Next Generation" die Lwaxana Troi. Majel Barrett-Roddenberry hörte man auch häufig als Computerstimme in den neuen "Star Trek"-TV-Serien, wie auch im kommenden Film. Ihre Aufnahmen zum im Mai 2009 kommenden Film "Star Trek" wurden noch komplett aufgenommen. In einer Episode der SF-Serie "Babylon 5" spielte sie die Lady Morella, und produzierte außerdem die SF-Serien "Andromeda" und "Mission Erde - Sie sind unter uns".
Some kind of "Star Trek": Mark Brandis - die Hörspiele
von Christian Humberg
Es geschieht mittendrin in „Bordbuch Delta VII“, dauert nur wenige Sekunden. Und ist doch programmatisch für dieses Hörspiel, und für die ihm zugrunde liegende Romanserie. Für die Überzeugung eines Autors wie Nikolai von Michalewski.
Mark Brandis, soeben von einer Weltraummission heimgekehrt, lässt sich von seiner Frau Ruth O†™Hara die politischen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit berichten. Ein Machtwechsel hat stattgefunden und radikales Gedankengut, menschenverachtende Methoden sind nun an der Tagesordnung. Eine Organisation namens Reinigende Flamme sorge nun dafür, dass Zucht und Ordnung herrsche. Ihre eigene Auffassung von Zucht und Ordnung, versteht sich.
Brandis reagiert, wie ein Held das nun einmal macht. „Ach, so heißen die diesmal also,“ murmelt er unbeeindruckt und fährt fort, seine Frau zu küssen.
Ein Putsch? Soso. Alles schon mal da gewesen †¦
Hinter dieser einen Zeile, diesem kurzen und beiläufigen Handlungsmoment, steckt eine ganze Philosophie, die in den 1970ern und 1980ern unzählige meist junge SF-Leser beeindruckt, um nicht zu sagen: geprägt hat. Geschichte wiederholt sich, sagt Brandis da unbewusst und im Subtext. Machthaber kommen und gehen. Doch entscheidend ist einzig die eigene Überzeugung, das eigene Moralempfinden, ob dies nun mit der aktuell gültigen politischen Satzung übereinstimmt oder nicht.
Die Romanreihe „Weltraumpartisanen“ von Nikolai von Michalewsky, verfasst unter dem Protagonistenpseudonym Mark Brandis, ist für viele Freunde der fantastischen Literatur so etwas wie ein Generationenphänomen: eine gemeinsame Erinnerung. Interplanar Produktion und steinbach sprechende bücher erlauben eine akustische Rückkehr und Wieder- (oder sogar Neu-)entdeckung: Mark Brandis wird zum Hörspielhelden.
Bordbuch Delta VII
Als Captain Mark Brandis, Crewmitglied des Raumschiffs Delta VII, nach mehrwöchiger Mission zur Erde zurückkehrt, hat sich die schmerzlich vermisste Heimat frappierend verändert. Samuel Hirschmann, der Präsident der EAAU (Europäisch-Amerikanisch-Afrikanischen Union), hat abgedankt und somit einer radikaleren, skrupellosen Regierung unter Gordon B. Smith Platz gemacht. In Folge haben sich Hierarchien verschoben, Loyalitäten gewandelt. In Metropolis, dieser ins Meer gebauten künstlichen Stadt, riecht es nach einem Putsch. Commander Harris, Captain Brandis und die restliche Besatzung der Delta VII sehen sich unfreiwillig vor die Wahl gestellt, sich der neuen politischen Richtung anzupassen, oder eigene Wege zu gehen und für die Überzeugungen einzutreten, die sie selbst für richtig halten.
Von 1970 bis 1987 erschienen 31 Bücher von Mark Brandis alias Nikolai von Michalewsky im Herder-Verlag. Eine Jugend-SF-Reihe hatte dieser starten wollen und den Autor um entsprechende Inhalte gebeten. Die Leserresonanz war beeindruckend und längst nicht nur auf dieses Publikum beschränkt, also wurde die Reihe zu einer langlebigen. Die „Weltraumpartisanen“ waren geboren und lieferten ihren Fans bunte und durchaus militärisch angehauchte Science-Fiction-Abenteuer, bei denen aber immer der Mensch im Vordergrund stand, Emotion über Technik siegte.
Muster-Hörspiele
Und jetzt sind sie wieder da. Was Balthasar von Weymann, Jochim-C. Redeker und ihr Team mit dem Hörspiel „Bordbuch Delta VII“, der Adaption des gleichnamigen ersten Romans der Brandis-Reihe, starteten und bislang mit zwei Fortsetzungen, „Verrat auf der Venus“ und „Unternehmen Delphin“ fortführten, ist ein beeindruckendes Unterfangen, deren Umsetzung begeistert. Schon die Aufmachung der ersten CD ist gelungen: Das Cover zeigt Metropolis als lebendige Metropole des 22. Jahrhunderts und macht deutlich, dass man es hier - bei allem verdienten Respekt vor der literarischen Vorlage - mit einem modern inszenierten und gestalteten Werk zu tun hat, das sich auf dem emsigen Audiomarkt nicht hinter ähnlichen Produktionen verstecken muss.
Das Drehbuch wandelt nicht nur die Romanhandlung gelungen in etwa 64 Hörspielminuten um, sondern fängt auch die Atmosphäre und den moralischen Subtext des Originals gekonnt ein. Wie Alexander Seibold in der aktuellen Ausgabe 28 von phantastisch! begeistert schrieb: „Bestimmte Sätze konnte ich schon vollenden, bevor sie zu Ende gesprochen waren.“ Bei Interplanar scheint man sich sehr bewusst zu sein, welch hohen Stellenwert die „Weltraumpartisanen“ bei vielen SF-Freunden einnehmen. Lobenswert.
Auch die Sprecher überzeugen. Besonders Michael Lotts Captain Brandis changiert gekonnt zwischen wehmütigen Sequenzen voller Selbstzweifel und Sorge, privaten und informellen Momenten mit Frau und Freunden, und der ansteckenden Durchsetzungskraft eines unfreiwillig zum Helden gewordenen Überzeugungstäters.
Ein gesondertes Lob gebührt auch der musikalischen Untermalung. Jochim-C. Redekers Score durchzieht weitaus mehr als nur der Hauch eines Epos. Diese melodischen und dramatischen Klänge atmen ganz klar Science-Fiction, könnten auch ohne die Handlung als reines musikalisches Werk bestehen. Wenn Hörspiele Kopfkino sind, macht dieser Klang sie zu 16:9.
Fazit
Schon klar: Ein Rezensent, der über ein Werk nur Gutes zu berichten weiß, ist nicht seriös. Immerhin sind die Jungs und Mädels doch dafür da, sich über Minderwertigkeiten aufzuregen, um an jedem noch so gelungenen Projekt noch das Quäntchen Mittelmaß zu finden, oder? Nun, dieser hier streckt die Segel. „Bordbuch Delta VII“, seine Nachfolger "Verrat auf der Venus" und "Unternehmen Delphin" sind alle genau das, was sie sein sollten: sehr gut besetzte, sehr gut inszenierte und verflucht gut musikalisch untermalte Hörspiele, die den Namen „Mark Brandis“ mit Würde tragen. Und ihn verdienen. Was sollte daran auszusetzen sein?
Ergänzung der Redaktion: Hörproben der bislang erschienen Hörspiel, Gratis-Klingeltöne und vieles mehr gibt es auf der Website http://www.sprechend...andis/index.htm. So kann sich jeder davon überzeugen, wie gut „Mark Brandis“ wirklich geworden ist.
Die Memmen des Meeres - the story so far
von Carolina Möbis
Zum besseren Verständnis: Dieser Corona-Fortsetzungsroman ist interaktiv, denn hier spielt der Corona-Leser mit! Wie früher in einem dieser alten Abenteuerspielbücher bestimmen Sie die Handlung. (Sie wissen schon: Wie damals in "Die absolut tödliche Insel des fürchterlichen Schreckens" und so weiter.) Aber anstatt zur Seite 170 oder 91 weiterzublättern, helfen Sie unserem Helden mit der Abstimmung auf unserer Website bei seinen Entscheidungsschwierigkeiten. Seien Sie die flüsternde Stimme im Wind und lesen Sie das Ergebnis in der nächstes Ausgabe des Corona Magazine.
1. Kapitel
Wieder und wieder pochen die Wellen gegen die Yacht. Unablässig, als würden sie nicht müde, den Eindringling zu mahnen: †šDu gehörst hier nicht her. Verschwinde.†˜ Die See liebt die Einsamkeit. Und darum liebe ich die See. Darum stehe ich auch hier draußen, allein. Die salznassen Planken der Déjà -Vu knarren erstaunlich wenig, als ich entgegen der Warnung der See an die Reling trete, und hinab starre. Doch ich kann nicht einmal die Gischt erkennen, die am Rumpf hinaufschießt. Draußen, außerhalb dieses kleinen Refugiums der Menschen ist nichts, kein Horizont, kein Himmel, keine Welt. Und das Wasser kann ich nur verzerrt hören, wie ein nahes und doch fernes Echo. Verdammter Nebel. Wo der nur so plötzlich herkommt? Man hört ja immer wieder von plötzlichen Wetterwechseln in der Ägäis. Aber so plötzlich?
Alles geschluckt, versunken in grauer Tristesse. Tristesse, was für ein luftiges Wort um eine Last zu beschreiben. Nur die Franzosen konnten so etwas erfinden. Das Lebensgefühl im Land des Belle-Esprit erlaubt keine Bedrückung. Höchstens Melancholie. Wie in einem Chanson treibt man zwischen den Ankerketten der Schwermut und den lichten Höhen schwärmerischen Träumens dahin. Diesen Zustand kenne ich gut, verbrachte ich doch meine halbe Jugend in dieser Seelenstimmung. Die feinen, salzigen Tröpfchen Dunst auf meinen Wangen, meinen Handrücken, erinnern mich an lang Vergessenes. Erdrückend und hauchdünn, ein undurchdringlicher Schleier. Doch umgibt er mich im Hier und Jetzt. Ausnahmsweise wallt er einmal nicht über meiner Erinnerung, sondern bringt einen kühlen Hauch mit wie einen verstohlenen Kuss. Unheimlich. Verheißungsvoll. Fast kann ich die See atmen hören.
Oder ich brauche ganz einfach mal wieder mein Mittel. Habe ich gestern in der Hektik überhaupt eine Tablette genommen? Eigenartig, es will mir nicht einfallen. Vielleicht sollte ich hinuntergehen und mir eine holen, aber vielleicht auch nicht. Schon lange war ich nicht mehr so wach. Ich spüre alles deutlich und intensiv. Das Auf und Ab des Schiffes, den Luftzug, den Duft von Wind und Salz. Ja sogar das, was fehlt, wie das Geräusch des Motors und das subtile Vibrieren des Decks. Beides ist weg. Wann wir den Motor abgestellt haben, weiß ich nicht. Oder warum. Womöglich haben wir aufgrund des Nebels die Fahrt unterbrochen. Ich sollte hinunter gehen und Johann fragen. Hubertus kann ich getrost ignorieren, der hat von Nautik wahrscheinlich ebenso wenig Ahnung wie ich. Aber es ist so schön hier draußen. Nur wir allein, der Nebel, das Meer, das Boot und ich. Verdammt, ich bin in der Phase. Also habe ich es gestern vergessen. Noch geht es, aber ich sollte spätestens mittags eine nehmen. Oder ist es schon Zwölf? Der Verlust des Zeitgefühls ist eines der ersten Symptome und ich Trottel lasse die Uhr natürlich liegen. Gleich werde ich hinunter - aber es ist hier so schön. So still. Wäre da nur nicht dieses Klopfen - Moment, das kommt von unter Deck. Was treiben die da? Ach egal. Schließlich ist das eine Urlaubsreise, da darf ich mir ja wohl etwas Ruhe gönnen. Auch wenn sich Johann nicht gerade entspannt aufgeführt hat. Allein auf dem Flughafen. „Daniel hier und Daniel schnell. Hast du alles? Wir wollen hier nicht Wurzeln schlagen.“ Als ob jemand freiwillig neben dem Bruchnagel ankern würde. Der Mann ist noch unsozialer als ich und das ist eine Leistung. Ganz anders als dieser Hubertus. Schleppt der doch heute Morgen planungsfrei, aber wenig überraschend zwei Bikini-Schlampen mit an Bord, deren Persönlichkeit ihren Namen entspricht: Kikki und Monique. Wenn ihm nicht die Yacht gehörte, mit der wir das hier veranstalten, dann wäre Johanns Szene bestimmt noch filmreifer ausgefallen. Aber was rede ich da, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Johann Bruchnagel und mir: Ich traue mich gemeinhin nicht, vernünftig mit Leuten zu reden, Johann kann nicht. Typisches Opfer des akademischen Elfenbeinturms.
Doch hier draußen verblassen solche Spitzfindigkeiten. Der Nebel schluckt sie, so wie er die ganze Welt geschluckt hat. Aber er hat auch etwas Tröstliches. Irgendwie. Wenn nur nicht dieses Klopfen die Stille so brutal zerreißen würde. Ach was, ich höre nicht hin. Ich lausche dem Rauschen der Wasser.
Sekunde, da ist noch etwas. Ein heller Ton. Ganz zart. Eine Tonfolge. Singt da jemand? Dort draußen? Auf den Wellen? Oder bilde ich mir das nur ein, weil der Nebel die Geräusche verzerrt?
Tja, was mache ich nun? Gehe ich hinunter und sehe nach, wer da warum klopft, oder bleibe ich hier und ergründe diesen eigentümlichen Gesang? Sagen Sie unserem Helden, was er tun soll, und zwar hier.
2. Kapitel
Ich ringe einen Augenblick mit mir, dann löse ich mich von der Reling. Ich finde ja doch keine Ruhe. Hohl und seltsam substanzlos kriecht mir das Echo meiner Schritte zum Steuerstand hinterher. Einsam blinken die Navigationsgeräte vor sich hin. Erstaunlich, ich hatte angenommen, dass Johann †¦ na, ich werde ja gleich sehen, wo er steckt.
Ich mag diese enge Treppe nicht. Wie schlecht gelaunte Türsteher drängen einem die Kabinenwände entgegen. Dann bin ich unten. Unser Aufenthaltsraum mit der Sitzecke aus weißen Leder und der Küchenzeile ist ebenfalls leer. Machen die eine Zimmerparty? Bei Heuchelheim passt das ja, aber Johann, der mit einer Badenixe schmust, nein, die Vorstellung ist zu absurd. Natürlich ist das Klopfen verstummt. Klar. So ist das ja immer mit beunruhigenden Geräuschen, schaut man nach, sind sie weg.
Damit mein Weg zumindest nicht ganz umsonst war, schlendere ich zu meiner Kabine. Praktischerweise haben wir fünf an Bord und ich muss mir nicht anhören, wie Johann nächtlich den Regenwald zugrunde richtet. Eine Nacht im Hotelzimmer war ausreichend. Danke.
In meiner Kabine sacke ich neben meine noch immer vollgepackte Reisetasche auf das schmale Bett und lasse den Blick über meine zwei mal drei Meter Privatsphäre schweifen. Plötzlich bin ich nicht mehr sicher, ob es eine so gute Idee war, mit fünf Leuten zu verreisen, von denen ich nur einen kenne und den mag ich nicht halb so sehr, wie man es von mir erwarten könnte. Bin ich wirklich so allein?
Verdammt, das muss ich abschütteln. Hat ja jetzt auch keinen Zweck mehr, zum Aussteigen ist es ein wenig zu spät. Was wollte ich noch? Ach ja. Ich wühle in der Tasche. Meine Finger kämpfen sich durch Socken und T-Shirts, bis sie die „Vitaminflasche“ umschließen. Wenn ich auf Reisen gehe, fülle ich das Solian extra in ein Fläschchen von Nahrungsergänzungsmitteln um. Das wirkt zwischen dem Rasierzeug unverdächtig. Besser, ich nehme jetzt gleich eine. Das Miese an diesen Anfällen ist, dass man nie so genau weiß, ob man einen hat, solange man drinsteckt. Man merkt es selbst erst so richtig, wenn es vorbei ist und alle anderen längst davon überzeugt sind, dass man spinnt. Dann bleibt einem nur noch die Möglichkeit, sich selbst einzuweisen, aber das wollte ich nie wieder tun. Außerdem: finde erst mal eine Klinik mitten auf dem Meer. Seit drei Jahren keine Attacken mehr, ich hatte mir so gewünscht, dass es endlich vorbei wäre. So muss es auch bleiben. Da nehme ich lieber die Müdigkeit und Kopfschmerzen in Kauf. Also prophylaktisch. Kommt schon her, ihr kleinen runden Miststücke.
Natürlich habe ich nicht dran gedacht, mir eine Flasche Wasser mit aufs Zimmer zu nehmen, also zurück in die Küche.
Ich stöbere in unseren Vorräte auf der Suche nach den Wasserkanistern, die wir gestern morgen an Bord geschleppt haben, da geht eine Kabinentür auf und Absätze klappern den Gang entlang. Ah, muss da eine Mieze aufs Katzenklo?
Muss sie nicht, denn sie stolpert in den Aufenthaltsraum und sieht sich um. Das Gesicht über den gefälligen Rundungen ist ziemlich bleich.
„Ick gloob†˜, ick muss kotzen“, nuschelt Kikki. Ihr Dialekt verrät zweifelsfrei die Berliner Göre. Wahrscheinlich ist sie eins von den Girls, die sich im Sommerurlaub an den Stränden Europas durchschnorren. Ihr gelbes Top sitzt wie selbstverständlich auf halb acht und zeigt ein bisschen mehr Haut als anständig wäre. In dem ehrlichen Bemühen, nicht zu gaffen, mache ich ihr Platz, damit sie ans Waschbecken kommt, denn ich bezweifle, dass sie es noch bis zur Toilette schafft. Oder zur Reling.
„Kannst du †¦ die Haare †¦?“, bringt sie noch halbwegs artikuliert hervor, was dann ihren Mund verlässt, hat eine starke olfaktorische Komponente. Ich stütze sie und halte wie gewünscht ihren wasserstoffgebleichten Zopf vom Waschbecken fern. Das Solian landet unauffällig auf der schmalen Arbeitsfläche zwischen einem Bund Zucchini und einer Palette Joghurt, die noch nicht eingeräumt wurden.
„Seekrank?“, frage ich, als Kikki sich den Mund unter dem Wasserhahn ausspült. Ich mag das Zeug nicht trinken, wer weiß, welche Bakterienkulturen sich da häuslich eingerichtet haben.
„Non, acht Martini“, erklärt hinter uns eine samtene Stimme mit französischem Akzent. Sie jagt mir einen nicht unangenehmen Schauer über den Nacken. Monique. Warum habe ich sie nicht kommen gehört? Ach, sie ist barfuß unterwegs. Und im Gegensatz zu ihrer Freundin halbwegs nüchtern.
Wenn ich zwischen den beiden Damen hin und her schaue, muss ich neidvoll anerkennen, dass Hubertus zumindest optisch einen guten Geschmack hat. Die zwei sind wie Schneeweißchen und Rosenrot. Im Vergleich zu Kikkis geradezu aufdringlicher Barbie-Weiblichkeit kommt die Französin mit diesem putzigen Akzent und ihrer schwarzen Carmen-Mähne wie eine Disney-Schöne daher. Aber was soll das Gefasel, keine von denen würde mich außerhalb dieses Schiffes auch nur wahrnehmen. Außerhalb der heilen Zeichentrickwelt hat sich Quasimodo schließlich auch vergeblich nach Esmeralda verzehrt.
Sie tritt zu Kikki. „Alles in Ordnung?“ Mich streift sogar ein kurzes, abwesendes Lächeln. „Danke.“ Das ist mir zuviel der Weiblichkeit. Bevor ich verlegen ins Stottern gerate, tauche ich lieber ab und begebe mich wieder auf die Suche nach dem Mineralwasser, diesmal nehme ich mir die unteren Schrankfächer vor, während Monique ihre Freundin zurück zu den Quartieren schiebt. Das Ausspülen des Waschbeckens bleibt natürlich an dem hängen, der sich nicht schnell genug aus der Affäre gezogen hat.
Kaum bin ich allein, geht das Klopfen wieder los.
Es kommt vom Heck, aus dem kleinen Lagerraum neben dem Badezimmer. Also gut, ich gehe, darum bin ich ja heruntergekommen.
Höflich wie ich bin, klopfe ich an. „Hallo?“
„Ach, du bist†™s!“, höre ich Johann durch die Tür. „Du kannst mir gerade assistieren. Bin gleich so weit.“
Wer bin ich eigentlich, James der Butler? Wenigstens kommt mein ehemaliger Professor voll bekleidet, nüchtern und nur eine Spur aufgeregt aus der Kammer, die kaum mehr ist als ein begehbarer Schrank.
„Ich habe ein Klopfen gehört“, erkläre ich.
Er nickt geistesabwesend und ich bezweifle, dass er mir überhaupt zugehört hat. Das ist eigentlich nur dann typisch für ihn, wenn er in einer Theorie schwelgt. „Jaja, schon möglich. Kannst du mir damit helfen? Ich krieg es nicht an die Wand. Dämliche Nägel, verbiegen sich ständig.“
Plötzlich baumelt eine Kupferplatte vor meiner Nase. Sie ist etwa 20 cm groß und hängt an einem kurzen, kräftigen Bindfaden. Ein talentierter Mensch hat anscheinend in Handarbeit eine Gorgonenfratze nach antikem Vorbild hineingehämmert. Und das will Johann auf von Heuchelheims tuffiger Yacht anbringen? Der Mann hat Sinn für Humor. Mit der anderen Hand hält er mir ein Häufchen verbogener Nägel hin. Er schnauft frustriert.
„Kein Wunder, dass es nicht funktioniert“, witzele ich, „ein Apotropaion muss außen angebracht werden.“
„Da hast du recht.“ Nachdenklich rauft er sich das schüttere, graue Haar. „Ich wollte eigentlich nicht, dass Hubertus es sieht, der stellt nur dumme Fragen. Aber du, du weißt, worauf es ankommt. Und natürlich hast du recht. Wenn es wirken soll, müssen wir es an den Mast hämmern oder am Bug anbringen.“
Johann sieht ganz ernsthaft aus. Der Archäologenhumor gefällt mir. Ich beschließe, mitzuspielen und auch einen Aberglauben beizusteuern.
„Und wenn ich mir die Nägel so ansehe, könnten wir damit das Nebelproblem lösen. Mein Großvater ist zur See gefahren, und der sagte immer, bei Flaute muss man mit einem alten Nagel am Mast kratzen. Zum Glück hat diese Lady einen.“
Das ist nicht einmal gelogen. Mein Großvater war wirklich Seemann. Korvettenkapitän. Seine wilden Geschichten über Seeungeheuer und Klabautermänner waren besser als die „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ und der „Malleus Maleficarum“ zusammen. Leider kann Johann über meinen Witz nicht lachen.
„Ich denke nicht, dass das uns in diesem Fall weiterhilft“, insistiert er todernst. „Aber wir sollten das Haupt wirklich †¦“ Er stockt mitten im Satz, dreht den Kopf, als würde er irgendetwas hören, und erstarrt.
„Johann?“
Auf einmal kommt wieder Leben in ihn, er reißt die Augen auf. Unvermittelt verengen sich die Lider jedoch zu kleinen Schlitzen. Die Falten auf seiner Stirn und um den Mund werden tief und hart, und für einen Moment blitzt tiefer Argwohn aus seinen Zügen. Schon ist der Spuk wieder vorbei. Johann entspannt sich. Wahrscheinlich habe ich lediglich einen seiner berüchtigten Stimmungswechsel gerade überinterpretiert.
„Daniel, könntest du das machen? Bring es an Deck an, irgendwo, wo es nicht auffällt. Weißt du, ich glaube natürlich nicht an derlei Firlefanz, aber ich habe es geschenkt bekommen. Und sag†˜ Hubertus nichts. Das kann doch unter uns bleiben, oder?“
„Klar“, bestätige ich langsam. Irgendetwas läuft hier nicht ganz rund. Die Bitte ist eine Spur bizarr. Andererseits, Johann Bruchnagel galt an der Uni schon immer als verschroben, und langsam begreife ich warum. Was soll†˜s, wenn es ihn glücklich macht.
„Gib mir den Hammer und die Nägel.“
Er atmet sichtlich erleichtert auf. Etwas übertrieben, diese Aufregung um einen Insidergag. Und wieso wollte er die Plakette in der Abstellkammer anbringen?
„Danke, Daniel.“
Im Gegenzug habe ich nun meinerseits eine Bitte.
„Könnest du in der Zwischenzeit zum Steuerstand gehen? Mir ist nicht wohl, dass wir hier im Nebel treiben und keiner die Geräte überwacht“, erkläre ich, „und Hubertus ist garantiert schon zu besoffen.“
Er nickt und steckt dabei die Hände in die Hosentaschen wie ein kleiner Junge, der gerade verbotener Weise in Mutters Keksdose gelangt hat. „Sicher, das kann ich tun.“
Na bitte. Weil ich sowieso nichts Besseres vorhabe, mache ich mich wieder auf an Deck. Die Gorgone grinst in bösartiger Verzückung.
Nachdem ich mich oben noch einmal umgesehen habe, - der Nebel hat keineswegs nachgelassen -, beschließe ich, den Kopf auf der Außenseite des Bugs anzubringen; gerade ist Windstille, da kann ich es schon riskieren, mich ein Stück über die Reling zu beugen. Oder ich binde das Ding einfach in die Wanten. So gibt es nachher auch keinen Ärger wegen der Nägel. Dank der Seefahrergene meines Großvaters hat mir selbst größerer Seegang nie etwas ausgemacht.
Aber ich habe die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Gerade stelle ich mich auf die Zehenspitzen, plötzlich zittert die Déjà -Vu. Hastig suche ich Halt am nächsten Stag. Tatsächlich! Der Bug bebt ein zweites Mal, diesmal begleitet von einem dumpfen Knarren, so als wäre das Schiff auf etwas gelaufen †¦ oder etwas gegen das Schiff geschlagen.
Draußen ist im Nebel immer noch nichts zu sehen. Aber die Wellen schmettern jetzt deutlich stärker gegen den Rumpf.
Ich schreie nach Johann und haste in Richtung Steuerstand. Irgendjemand muss unseren Kurs bestimmen. Fast habe ich es geschafft, da greift eine Hand meine Schulter. Sie ist real. Ich fühle den Druck.
Aber das kann nicht sein, ich bin doch allein hier oben. Eine flüsternde Stimme warnt mich. „Dreh dich nicht um!“ Eine andere lockt mich, genau das zu tun. Mit einem Mal poltert es unter Deck und eines der Mädchen kreischt. Wind kommt auf.
Was soll ich jetzt machen? Ich muss mich schnell entscheiden: Bleibe ich und stelle mich dem, was mich verfolgt, oder reiße ich mich los und versuche noch einmal, unter Deck zu helfen? Sagen Sie unserem Helden, was er tun soll, und zwar hier.
3. Kapitel
†šDreh dich um, dreh dich um!†˜, befehlen die Stimmen. Berückend. Bezwingend. Und ich folge ihnen. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen, wende ich mich um. Und sehe †¦ nichts. Die Hand ist fort. Hat es sie je gegeben? Nein, natürlich nicht, ich bilde mir das alles nur ein. Verdammt, wieso habe ich das Solian vergessen? Ich brauche es dringend. Äußerst dringend, denn ich spüre Phantomberührungen und höre unwirkliche Stimmen. Scheiße, ich SEHE unwirkliche Dinge. Und zwar soeben!
Aus dem Nebel schält sich tatsächlich eine bleiche, dünne Hand. Sie kann nicht echt sein. Nur eine Illusion. Echte Hände haben nicht so spindeldürre und lange Finger. Und auch nicht derart spitze Krallen. Ein knochengleicher Finger lockt mich tiefer in den Nebel. Und auch die Stimmen treiben mich voran. Diesmal bleiben sie stumm, aber ich weiß, dass sie da sind. Sie warten ab, sie wollen es sehen. Und so folge ich dieser gespenstischen Hand, die zu einem nicht minder bleichen Arm gehört, den ich kaum erkenne. Schließlich stehe ich vor dem Mast. Die Hand ist verschwunden. Dennoch folge ich einer ungewissen Ahnung und blicke nach oben. Tatsächlich, in den Wanten turnt jemand und reckt sich wie ein Schiffsjunge im Ausguck. Ein blinder Passagier? Wir haben keine Kinder an Bord, aber nur das würde einigermaßen plausibel erklären, warum der Kletterkünstler entsetzlich schmächtig und kaum einen Meter groß ist. Oder warum er einen kitschigen blauweißen Matrosenanzug trägt, den ich sonst nur von alten Postkarten kenne. Die Frage wird allerdings belanglos, als die Gestalt auf mich herabblickt. Das Gesicht ein paar Meter über mir ist überhaupt nicht kindlich. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob es †šmenschlich†˜ zu nennen ist. Zu groß und schräg stechen die Augen aus einem hageren Gesicht hervor, die Wangen sind milchig-weiß und doch zerfurcht und wettergegerbt, wie die eines alten Seebären. Rotes Haar. Rotes, zerzaustes Haar steht nach allen Richtungen vom Schädel ab und ich weiß, dass das eine Bedeutung hat, auch wenn sie mir gerade nicht einfallen will. Erst als sich dünne Lippen strecken und eine Reihe grüner, spitzer Zähne freigeben, begreife ich, wen ich ganz unzweifelhaft vor mir habe. Sofern eine Halluzination eine Identität hat. Ich öffne den Mund. Was ich sagen will, weiß ich eigentlich nicht. Das ist auch kein Problem, es dringt sowieso kein Ton aus meiner Kehle. Stumm wie ein Fisch beobachte ich den Klabautermann, wie er die Hände bewegt, als drehe er ein imaginäres Steuerrad. Dabei starrt er ohne Pause, ja ohne einmal zu zwinkern, zu mir herab. Plötzlich formen die mageren Lippen zwei Worte. „Hart Backbord“, keiner von uns äußert auch nur den geringsten Laut, aber ich verstehe ihn. Er spürt es. Muss es spüren, denn ohne Vorwarnung verschwindet er. Von einer Sekunde auf die Nächste.
Ich kann mich noch immer nicht von der Stelle rühren. Nicht, weil mich etwas festhält, es ist nur †¦ ich treffe nicht alle Tage Fabelwesen. Was mag diese Erscheinung bedeuten? Vorausgesetzt, dass sie nicht nur ein Produkt meiner übereifrigen Phantasie ist. Aber selbst wenn ich mir alles nur ausgedacht habe: vielleicht steckt ja dennoch eine Bedeutung dahinter, dass ich mir diese Gestalt zu dieser Zeit mit dieser Botschaft imaginiere. Der Klabautermann zeigt sich eigentlich nur dem Kapitän des Schiffes und zwar im Augenblick höchster Gefahr. Sind wir etwa in Gefahr? Hat er mich gewarnt und will, dass ich unseren Kurs ändere?
Wie Feuerwerk sprühen meine Gedanken und entgleiten mir, noch bevor sie sich zu Plänen geformt haben. Da ich im Augenblick nur einen einzigen von ihnen festhalten kann, schlurfe ich wieder in Richtung Steuerstand. Es muss ja sowieso jemand unseren Kurs bestimmen und die Schnarchnasen unter Deck sind bestimmt noch damit beschäftigt, Hölzchen zu ziehen, wer hier die Verantwortung übernimmt.
Aber diesmal ist der Steuerstand tatsächlich besetzt. Warum kann denn nichts im Leben einfach sein? Unser Gastgeber, Hubertus von Heuchelheim, lehnt lässig im Sitz vor dem Kompass und zieht eine Augenbraue hoch, als ich von draußen hereinkomme.
„Alles in Ordnung?“, frage ich. Aber die Frage erübrigt sich, Heuchelheims Selbstgefälligkeit ist beredter als jede verbale Bestätigung. „Wir driften gerade ein bisschen, aber das gibt sich sicher bald, wenn sich das Wetter ändert. Also können wir durchaus warten. Wir haben ja nichts Spezielles vor, oder Dennis?“ Er lächelt sein Ladykillerlächeln. Nicht, dass ich was davon habe, aber ich muss neidvoll anerkennen, dass ihm das überlegene, charmante Grinsen ebenso gut steht, wie die sonnenbadgebräunte Haut und das blonde kurze Haar. Selbstverständlich besitzt er, dank eines eigenen Fitnesstrainers, diese derzeit so angesagte sportlich-dynamische Aura. Ich bin sicher, sein Bild steht im Lexikon unter †šMärchenprinz†˜. So einer kann es sich auch leisten, die Namen anderer Leute zu vergessen.
„Ich heiße Daniel.“
„Ach, je regrette.“
Gott, und dann noch dieses affektierte Französisch! Das kann er sich von mir aus gerne sonstwohin regretten. Wie blöd war ich, dass ich freiwillig mit ihm wegfahre?
Über meinem Ärger vergesse ich beinahe, warum ich gekommen bin.
„Bist du sicher, dass wir keine Probleme haben? Ein Hindernis vor uns, oder sowas?“
„Wie kommst du darauf?“
Ein flüchtiger Blick über sein Schulter auf die Anzeigen beweist mir, dass er nicht lügt: Aber ebenso weiß ich einfach, dass uns etwas bevorsteht. Ich bin so sicher, wie man sein kann, wenn man die Realitäten wechselt wie seine Hemden. Wichtig ist eins: Wenn ich handle, dann jetzt sofort oder es wird zu spät sein.
Was also tun? Überrumple ich von Heuchelheim und reiße einfach das Ruder nach Backbord oder gehe ich hinunter, überlasse dem Dandy das Führen seiner dämlichen Yacht und hämmere mich stattdessen mit Solian in die schützenden Tiefen der seelischen Taubheit?
Hey Stimmen, jetzt wo ihr wieder da seid, sagt ihr es mir!
4. Kapitel
„Geh. Lass es“, raunt der Chor in meinem Kopf. „Mach dich nicht lächerlich.“ Eigentlich hat er Recht. Ich wende mich zur Treppe. Da fallen neue Stimmen ein. Schneidend. Entschlossen und lauter als je zuvor. „Bist du verrückt? Jetzt aufzuhören? Warnungen bekommt man nicht ohne Grund.“ Verwirrt verharre ich. „Nun sei doch nicht so passiv!“, stichelt eine besonders perfide Stimme. Etwas von dem, was in mir vorgeht, muss sich auf meinem Gesicht widerspiegeln, denn Hubertus sieht skeptisch zu mir hoch. Lässig hat er sich zurückgelehnt und lenkt mit dem Fuß in den Speichen des Steuerrades. Auf den Kompass steht ein halbvolles Whiskyglas. Verdammte Landratte. Doch was rede ich - bin ja selbst eine. Auf jeden Fall ist der eitle Geck ein gutes Beispiel dafür, wohin ein paar Jahrhunderte Inzucht im Adel führen. Doch die mentale Überlegenheit nutzt mir nichts, da es in meinem Hirn immer noch wie bei Jerry Springer zugeht.
„Dennis? Alles klar?“, dringt es wie durch Watte. Hat sich der Nebel jetzt auch auf meine Ohren gelegt? Zu laut streiten die Stimmen darüber, was ich jetzt tun muss. Es geht hin und her. Bis es mir zuviel wird.
„Hey, Dennis, du bist ja ganz bl-“
Ich habe die Nase voll davon, dazustehen wie ein Vollidiot. Also packe ich das Ruder und reiße es herum.
„Spinnst du?!“ Durch den heftigen Ruck am Steuerrad reißt es Hubertus die Beine weg und er landet unsanft auf Deck. Zumindest kommt er dadurch nicht sofort auf die Idee, den Kurs wieder zu ändern. Meine Schadenfreude hält sich aber in Grenzen, weil durch die Schiffsdrehung der Whisky vom Kompass rutscht und sich über mein linkes Hosenbein ergießt. Wir fluchen beide. Im Nachhinein verfluche ich mich. Nun stehe ich doch als Idiot da. Wie soll ich dem Snob meinen Ausfall plausibel machen? Der Klabautermann kann als Referenz jetzt wohl kaum herhalten. Während ich mir noch den Hinterkopf reibe und vergeblich nach einer logischen Erklärung für all das suche, rappelt sich Hubertus auf und setzt zu einer wütenden Tirade an. Ich richte mich schon auf ein verbales Kielholen ein, da geschieht etwas Seltsames. Hubertus bewegt die Lippen, aber es kommt kein Ton heraus. Die plötzliche Ähnlichkeit mit dem Goldfisch aus dem Gartenteich meiner Großmutter zwingt mich, mir ein Grinsen bewusst zu verkneifen, bis mir klar wird, dass er auf etwas hinter mir starrt. Sofort fahre ich herum und spähe durch das Kabinenfenster. Der Anblick treibt meinen Puls nach oben und wahrscheinlich schaue ich im Augenblick ähnlich intelligent wie von Heuchelheim aus der Wäsche.
Dort draußen, Steuerbord, gleiten die Schemen eines anderen Schiffs an uns vorbei. Ein schwarzer, hölzerner Mast lässt sich erahnen, eine breite Querstange, darunter ein Flattern und Bauschen. Die Reste eines Segels? Da ist stehendes und laufendes Gut in eigenartiger Anordnung. Alles spannt fast ausnahmslos zum Heck hin, das wir schon hinter uns gelassen haben. Unter der Reling erkenne ich Reste von Rudern. Schief und Morsch harren die zerbrochenen Stangen aus wie die letzten vergreisten Zeugen einer Tragödie.
Wer zur Hölle-? Doch es ist vor allem der Bug, der mich beunruhigt. Ein Bugspriet, wie ich ihn nur von Bildern kenne. Fast senkrecht, dennoch ein Stück nach außen strebend, ragt er hervor wie ein Haken. Es dauert eine Weile, bis ich begreife, dass das Wrack, das an uns vorübergleitet, oder besser: an dem wir vorbeiziehen, einem antiken Kriegs- oder Handelsschiff gleicht.
Bevor ich mich jedoch zu sehr wundern kann, woher dieses Schiff kommt, geht ein Ruck durch unseren Rumpf. Ein sekundenlanges leises Schaben beweist, dass wir an etwas vorbeischrammen. Doch bevor ich den Steuerstand verlassen kann, um zu schauen, womit wir kollidieren, fahren wir schon wieder ruhig. Dabei sind wir dem fremden Schiff nicht zu nahe gekommen. Die Langsamkeit, mit der wir es passieren, kann nur eins bedeuten.
„Eine Sandbank. Das Schiff liegt auf einer Sandbank.“
Erst als der Nebel das unheimliche Wrack verschluckt hat, sehen wir uns wieder an. Unter seinem gebräunten Teint ist Hubertus ziemlich blass geworden. Ich bin ebenfalls noch ganz erschüttert und brabble Halbsätze, die ich nicht zu Ende führe, über „Alt“ und „Antik“.
„Daniel! Woher wusstest du das?“
Jetzt brauche ich umgehend eine schlagfertige Erwiderung.
„Ähh †¦ Intuition?“
Großartig! Das war rhetorisch brillant! Das glaubt er mir bestimmt.
„Ach komm, das hast du doch nicht im Gefühl. Du wusstest, das da was vor uns ist, ohne die Kursänderung wären wir wahrscheinlich direkt aufgelaufen.“
Hubertus†˜ blaue Augen mustern mich voller Neugier und zugleich mit einem verhaltenen, schlecht verborgenen Misstrauen, das mich unvermittelt an Johanns Reaktion erinnert, als er über die Gorgone gesprochen hat. Die Gorgone! Wo habe ich sie eigentlich? Ah, sie steckt in meiner Hosentasche.
„Ich †¦ hatte †¦ einfach so eine Ahnung“, bekräftige ich, mit dem mir ureigenen Mangel an Eloquenz. Natürlich glaubt mir Hubertus kein Wort, aber er kann mir auch nicht das Gegenteil beweisen. Also bricht er die Diskussion ab. „Da haben wir also nochmal Glück gehabt.“ Er setzt sich wieder.
Ich nutze die Gunst der Stunde, um ihm über die Schulter zu schauen. „Weißt du, ich wundere mich, warum uns das Echolot nichts angezeigt - “
In diesem Augenblick stoppt Hubertus die Maschinen.
„Was tust du?“
„Ich denke, wir werden hier ankern und uns dieses Wrack mal anschauen.
„Was?“
Hubertus ist wieder ganz der selbstsichere Draufgänger. „Was hast du gegen ein bisschen Abenteuer? Das Schiff liegt da schon eine Weile, Johann wird es bestimmt auch interessieren. Vielleicht sind wir ja die ersten, die es finden.“
Sicher. Klar. Ausgerechnet wir stoßen zuerst auf ein antikes Segelschiff, das kurz vor der türkischen Küste nur auf ein paar Touristen wartet, um entdeckt zu werden. Und morgen finden wir den Koloss von Rhodos. Das Leben ist doch kein Actionfilm! Wahrscheinlich ist das Wrack noch nicht einmal besonders alt und ich habe mich nur geirrt. Es wird irgendein Fischerboot sein. Das sage ich ihm auch. Und weise auf den Nebel und die mangelhafte Ortung durch unsere Geräte hin. Nach diesem Erlebnis wäre es um Längen angebrachter, sich mit der Seekarte und dem Sonar zu befassen, als mit einem hirnrissigen, ungeplanten Entdeckungsunternehmen.
„Komm schon, Dennis.“ Hubertus klopft mir jovial auf die Schulter. „Sei doch nicht so eine verdammte Spaßbremse. Die Mädels wollten sowieso mal schwimmen. Und an was klammerst du dich da eigentlich so?“
Ich blicke an mir herab. Tatsächlich - in der rechten Hand halte ich das Gorgonenhaupt. Ich kann nur nicht sagen, wann oder warum ich es aus der Tasche genommen habe. Wahrscheinlich aus purer Nervosität. Der ganze Trip hier zehrt so langsam an meinen Nerven.
„Weißt du was, holen wir doch Johanns Meinung ein“, schlägt Hubertus vergnügt vor. „Wozu haben wir einen Archäologen an Bord, der die Situation bestimmt am besten bewerten kann?“
Johann hat zwar nicht gerade Ahnung von der Seefahrt, aber dafür einen gesunden Sinn für Verantwortung. Als Wissenschaftler wägt er viel zu gut ab, was er tut. Sicher wird er Hubertus diese Schnapsidee ausreden. Also stimme ich zu. Wir rufen Johann.
Kaum dass er sich die schmale Treppe hochzwängt, schon redet Hubertus auf ihn ein. Mein ehemaliger Dozent braucht eine Weile, bis er begreift, was wir von ihm wollen, aber sobald wir ihm die Geschichte erklärt haben, reagiert er, wie ich angenommen hatte. „Ich halte das für keine gute Idee“, beginnt er, allerdings weit bedächtiger und unsicherer als ich erwartet hatte. Ihm muss doch klar sein, wie bescheuert Hubertus Vorschlag ist.
„Glaub mir, es wird interessant sein.“ Unser Dandy lächelt Bruchnagel vielsagend an. Dabei entgeht mir der kurze Blick Heuchelheims zum Kompass ebenso wenig wie der Ausdruck der Verblüffung, der so ungefähr eine Nanosekunde lang über Johanns Züge gleitet. Was immer die beiden gerade ausgetauscht haben, es ändert Johanns Einstellung kolossal.
„Wir sollten es probieren“, erklärt er plötzlich selbstzufrieden. „Immerhin, wenn es tatsächlich von historischem Wert ist, dann ist es besser, wir untersuchen es, bevor es unwissende Laien zerstören. Wie wäre es Daniel, Lust auf ein bisschen angewandte Archäologie?“
Jetzt fängt der auch noch an. Die beiden glauben doch nicht im Ernst, dass sie in dem Wrack irgendetwas von Wert finden. Stattdessen führen sie sich auf, als hätten wir Rungold entdeckt.
„Ich halte das für unsinnig“, versuche ich es ein letztes Mal mit Logik. „Rufen wir doch lieber die Küstenwache und fragen, was das hier draußen ist.“
„Blödsinn!“, unterbricht mich Hubertus, bevor ich meiner Skepsis weiter Luft mache. „Johann hat zugestimmt. Also ziehen wir es durch. Du kannst mitkommen, aber du kannst es auch gern lassen, wenn du damit ein Problem hast. Mir ist das egal.“
Wie um mir zu zeigen, dass die Diskussion beendet ist, steht er auf und geht zur Treppe.
„Ich sage den Mädels Bescheid.“
Drehen denn jetzt alle durch? Und was soll ich nun tun? Gehe ich mit, um herauszufinden, ob Hubertus†˜ und Johanns Hoffnung berechtigt ist, oder bleibe ich an Bord und versuche herauszufinden, ob sich hier irgendetwas abspielt, von dem ich nichts weiß? Immerhin scheint der Kompass etwas mit der Sache zu tun zu haben und den könnte ich mir näher anschauen.
Sagen Sie unserem Helden, was er tun soll, und zwar hier.
5. Kapitel
Hubertus verschwindet nach unten. „Hey“, tuscheln die Stimmen plötzlich, „du willst denen doch nicht den ganzen Spaß lassen. Stell dir vor, ihr habt wirklich etwas entdeckt, dann fällt auch ein bisschen Ruhm für dich ab. Willst du dein Leben lang der langweilige Stubenhocker sein?“ Ich nicke benommen. Wahrscheinlich haben sie recht. „Und denk an die knackigen Chicas im knappen Badedress.“ Eine der Stimmen kichert. „Vergiss es“, denke ich so entschlossen, wie ich kann. „So einer bin ich nicht.“ Die Stimme kichert wieder. „Aber ich!“
„Sei still!“ Habe ich das gerade laut gesagt?
Johann verschränkt entrüstet die Arme. „Was ist denn in dich gefahren? Ich bin doch ganz ruhig.“
„Uh oh“, maunzt mein mentaler Plagegeist pathetisch.
„Nicht du“, erkläre ich Johann hilflos, aber der winkt ab. „Das nimmt dich ja ganz schön mit. Daniel, du musst auf deine Nerven aufpassen. Ein kleiner Ausflug tut dir vielleicht ganz gut. Komm, wir ankern und machen das Beiboot klar.“ Das tun wir auch und lassen es zu Wasser. Dann packen wir noch einen Ersthilfekasten, eine dünne, aber grundlegende Seenotausrüstung, und ein paar Dinge, die wir zur Erschließung des Schiffes brauchen werden. Das wichtigste Utensil ist dabei fraglos die dem Archäologen praktisch in die Hand implantierte Lupe. Ich ziehe mir eine Schwimmweste an. Schließlich beehren auch Hubertus und Monique das Deck mit ihrer Anwesenheit. Natürlich tauchen sie auf, als wir so gut wie fertig sind. Das Talent mancher Leute, Arbeit aus dem Weg zu gehen, ist nachgerade beeindruckend. Aber noch beeindruckender sind die netzhautzerstörenden Farben der Karibikkulisse auf dem Hawaiihemd, in das der Dandy sich aus irgendeinem Grund geworfen hat. Monique trägt keinen Bikini, sondern ein Tank Top und Shorts wie ich mit einem klitzekleinen bisschen Bedauern feststelle.
„Wir sind eben Perverse der alten Schule.“
„W i r nicht!“
Mit aller Macht konzentriere ich mich auf etwas, das nicht Monique oder eine Stimme in meinem Kopf ist.
„Wo ist Kiki?“, frage ich und tue dabei, als würde ich die Ausrüstung im Beiboot begutachten, die Johann gerade verstaut.
„Schläft ihren Rausch aus“. Heuchelheim klettert hinein. „Ihr Pech.“
Bleiben noch Monique und ich. „Kommst du klar?“, frage ich aus purer Verlegenheit, als ich ihr den Vortritt lasse. Dafür kassiere ich einen verächtlichen Blick, der die Lufttemperatur auf Winterniveau sinken lässt. „Bien sûr.“ Oh nein. Am Ende ist sie eine von diesen modernen Emanzen, die auf dem Wort Feministin bestehen und in jedem Anzeichen von Höflichkeit eine persönliche Beleidigung sehen. Zum Glück muss ich darauf nicht antworten, denn sie klettert, ohne abzuwarten, an der Leiter hinunter. Ich folge ihr und wir setzen über. Hinter uns verschwindet die Yacht in der grauen Stille.
Als wir endlich die Nebel durchdringen und schon fast gegen die Bordwand des Wracks stoßen, jubelt Johann lautstark. Allein die Tatsache, dass wir in einem Boot sitzen, scheint ihn davon abzuhalten, einen Freudentanz aufzuführen. Ich habe ihn noch nie so gelöst erlebt. Plötzlich kann ich mir vorstellen, dass sogar er eine Kindheit gehabt hat. „Seht euch das an, eine Monere, eine Monere!“
„Was soll das denn sein?“, fragt Hubertus irritiert, ob Johanns augenscheinlichen Tremendums.
„Das ist ein frühes Kriegsschiff, das noch alle Ruderer auf einem Deck hatte, die Argo soll so eins gewesen sein“, erkläre ich abwesend und mustere den Rumpf, den wir umrunden. Tatsächlich scheint das Schiff die Idealmaße dieses Typs zu haben. Die Länge kommt mit etwa 15 Metern hin, ebenso die Breite von reichlich drei Metern oder die Anzahl der Ruder, es sind neun. Die Sandbank ist nicht zu sehen, sie bleibt anständiger Weise ein Stück unterhalb unseres kleinen Kiels und macht uns keinen Ärger. Die gezimmerten Holzbretter, dunkel und rissig von Wasser und Salz, sehen schon ziemlich mitgenommen aus. Muscheln und zahllose Flutränder zaubern ein psychedelisches Muster auf die Bordwand. Das Deck verbirgt der Nebel. Hatten sich hier ein paar Hobby-Experimentalarchäologen ausgetobt und waren gescheitert?
Jeder denkt das gleiche: dass es völliger Wahnsinn ist, hier herumklettern zu wollen. Aber nur einer spricht es aus. Die Frau. Natürlich die Frau. Sie runzelte die Stirn.
„Ist es das wirklisch wert?“
„Wer nichts riskiert, lebt nicht“, beglückt uns Hubertus mit einer seiner fragwürdigen Lebensweisheiten. Damit ist das Thema auch schon wieder Geschichte.
Wir vertäuen das Beiboot an einem Ruderstumpf, der einigermaßen stabil aussieht. Überhaupt herrscht in Momenten des Schweigens eine geradezu gespenstische Stille, nur der hohle, eintönige Wellenschlag rauscht in seinem eigenen Rhythmus. Dann zögern wir, denn niemand will als Erster vom Beiboot aus über die verwitterte Reling klettern. Dazu muss man nämlich springen und sich festhalten. Selbst die zwei begeisterten Obersucher haben plötzlich Manschetten. Bevor wir bis in alle Ewigkeit hier rumstehen und genauso salzverkrustet sind wie die Monere, ziehe ich die bei Archäologen beliebten Handschuhe an und seufze schicksalsergeben. „Okay, ich mach†™s.“
Johann klatscht in die Hände. „Großartig. Ich wusste immer, dass in dir ein richtiger Archäologe steckt, Daniel“, sagt der Mann, der hier unbedingt her wollte, zu dem Skeptiker.
Weil ich im Nacken sechs erwartungsvolle Augen spüre, stoße ich mich ab und klammere mich an das erstbeste Stück Reling, das mir unter die Finger kommt. Es klappt. Das Holz ächzt, bleibt aber stabil und ich ziehe mich daran hoch. Auf Deck erwartet mich ein schauderhafter Anblick.
Entfernt höre ich Hubertus Stimme, während ich auf die Skelette starre. Das ist nicht wahr! Das können unmöglich bronzezeitliche Waffen oder Kleidung sein. Diese von Muscheln und Seetang überzogenen Leichen, die verrenkt oder zusammengekrümmt auf Deck liegen, können keine dreitausend Jahre überdauert haben. Ich sehe riesige Zahnlücken, als wären die Zähne ausgeschlagen worden. Hier eine einzelne Hand. Dort ein kleines Knochenbündel eingewickelt in Seetang. Vielleicht die Reste eines Unterschenkels samt Fuß. Eine Leiche liegt da, als sei sie von einem gerissenen Tau erdrosselt worden, sogar die Reste des Taus sind noch um den Hals geschlungen. Bei der Witterung können die unmöglich konserviert worden sein. Irgendwer ruft ganz leise meinen Namen.
„Leute, kommt besser nicht hoch“, sage ich mit zittriger Stimme über die Schulter hinweg, aber ob sie mich verstehen, ist mir gerade durchaus egal, denn ich kann meinen Blick nicht von dem Leichnam abwenden. Die leeren dunklen Höhlen, dort, wo einst menschliche Augen lebten und lachten, blicken in meine Richtung, zu mir hin, direkt zu mir, starren mich an! Er starrt mich an! Ich kann es spüren! Und richtig schlecht wird mir, als ich merke, dass er nicht der einzige ist. Sie alle starren mich an! Aber, das ist bizarrer Weise nicht das Allerschlimmste. Ich kenne dieses Boot! Es kommt mir vor, als hätte ich schon einmal hier gestanden, hier und überall sonst an Bord. Ich weiß sogar, wo der Zugang zum Unterdeck ist. In der Nähe des Mastes, dort wo jetzt ein Teppich aus Seetang die Planken überwuchert.
Plötzlich wackelt ein Gesicht verschwommen vor meinen Augen, eine Hand kommt dazu, wedelt, und haut mir schließlich eine runter. Das bringt mich schmerzhaft, aber wirkungsvoll, zurück ins Hier und Jetzt. Vor mir steht Johann und hält meine Schultern. „Daniel, was ist nur mit dir los? Du bist ganz blass und hast überhaupt nicht reagiert.“
„Der hat einen Schock, wie ein Mädchen bei einem Romero-Schinken.“ Hubertus hob die Schultern. „Wenigstens kreischt er nicht rum.“ Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
„Nein, ich - mir geht†™s gut.“
„Ach ja, dann fang mit an zu suchen.“
„Wonach suchen wir denn?“ Diese Zielstrebigkeit verwirrt mich schon wieder.
„Überreste, Relikte, natürlich. Mann Dennis, manchmal bis du echt dumm wie zwei Meter Feldweg.“
Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Aber wenigstens macht der Ärger mich wieder handlungsfähig. Wahrscheinlich bringt er mir auch wieder Farbe ins Gesicht, denn Johann lässt mich los. „Alles klar?“, vergewissert er sich.
Ich nicke. „Ja, mir geht†™s gut.“
„Na, dann kann†˜s ja losgehen.“ Fröhlich vergisst mich Johann und widmet sich der nächstbesten Leiche. Ebenso Hubertus. Nur Monique und ich können dem allgemeinen Fleddern - Sichern des Fundes unter Auslassung der Dokumentation - nichts abgewinnen. Sie sieht so verstört aus, wie ich mich fühle, und bleibt zu meiner Überraschung in meiner Nähe. Mein Eindruck, das Boot zu kennen, lässt mich nicht los und ich sehe nur einen Weg, die Wahrheit herauszufinden. „Lass uns den Seetang wegräumen“, schlage ich vor. Sie nickt. So muss sie wenigstens keine Knochen anfassen. „Aber pass auf, wo du hintrittst“, warnt sie mich und ihre Stimme zittert ein bisschen. „Es ist alles morsch.“ Ich lächle ihr beruhigend zu. Dann schieben wir Wasserpflanzen mit den Händen fort.
Ich schwanke, ob ich erfreut oder entsetzt sein soll, als wir tatsächlich eine Bodenluke zu Tage fördern. Ebenso wie ich weiß, dass ich sie nun gleichwohl öffnen muss, weiß ich auch, dass ich das gar nicht will.
Hubertus und Johann retten mich aus meinem Dilemma. „Was ist das für Zeug?“, fragt Hubertus und hält Johan zwei angelaufene, faustgroße Scheiben hin. Mit der Akribie der wahren Leidenschaft befreit der Archäologe die Funde mit einem kleinen Pinsel vom maritimen Dreck der Äonen. „Das sind Schutzamulette aus Elektrum würde ich sagen“, doziert er dann versunken. „Dieses zeigt einen Pegasus. Dürfte korinthischer Provenienz sein, du weißt schon, Korinth, der Pegasos als Symbol der Stadt Poseidons.“
„Jaja“, unterbricht ihn Heuchelheim ungeduldig. „Ist es wertvoll?“ Oh wie abstoßend diese Frage angesichts solcher Kulturschätze doch ist.
„Aber ja.“ Mein ehemaliger Professor nickt heftig.
„Und das andere?“
„Das stammt vermutlich aus Attika. Sieh nur, eine seltene Darstellung. Eine Schlange mit Eulenaugen. Die Eule, das Symbol der Athene. Eulen nach Athen tragen, du verstehst schon. Und die Schlange? Auch eines ihrer Attribute. Das hier selten und wurde meines Wissens nur innerhalb der Priesterschaft Athenes getragen. Mein Freund, das ist perfekt!“ Entzückt blickt Johann auf und presst eine Faust vor den Mund. Hubertus grinst zufrieden. Wenn sie sich jetzt gleich noch in die Arme fallen, werde ich für sie eine Geige imitieren. Aber neben mir räuspert sich Monique leise und gemeinsam starren wir wieder auf die unsägliche Klappe. Ach, was soll†˜s. Ich reiße. Natürlich ist das nasse Holz verzogen und so komme ich gehörig ins Schwitzen, bevor sie endlich doch aufspringt. Darunter gähnt ein schwarzes Nichts. Eine kleine Taschenlampe enthüllt uns jedoch die Reste einer Treppe.
„Das sieht aber verrottet aus“, stellt Monique nicht zu unrecht fest.
Ich seufze. „Ich weiß. Aber das klappt schon“, beruhige ich uns beide, denn ich werde nach unten gehen. Die Ungewissheit zieht mich hinab wie ein Sirenenruf. Jeden Schritt mache ich mit angehaltenem Atem, aber das Schicksal ist mit den Mutigen und so komme ich wohlbehalten unten an. Doch leider bleibt mir keine Zeit, mich umzusehen. Denn kaum habe ich das untere Ende der Stiege erreicht, höre ich Moniques kleine Füße die schadhaften Planken hinunter tapsen, dann ein lautes Krachen, meinen Namen, und Monique liegt bis zum Hals im Wasser, auf ihr die Überreste der Stiege. Sie schlägt panisch um sich.
Ich muss mich wieder einmal entscheiden. Eile ich Monique zu Hilfe und riskiere ich, selbst mit abzustürzen, oder gehe ich auf Nummer sicher, rufe die anderen und warte, bis sie da sind?
6. Kapitel
„Rette sie!“, singt der Chor in meinem Kopf einhellig. Und wisst ihr, Stimmen, ihr habt ja Recht. Ich darf Monique nicht im Stich lassen. Auch wenn mir die Courage auf Grundeis geht, denn die alten Planken ächzen unter meinen Füßen nicht gerade vertrauenerweckend. Darum krieche ich sicherheitshalber auf allen Vieren an das Loch heran. Eine Armeslänge unter mir dümpeln die Reste der Stiege und des eingebrochenen Bodens. Unter geborstenen Brettern schimmert schwarzes Haar hervor. Moniques weiße Hände suchen verzweifelt nach einem sicheren Halt. Ich rutsche an den Rand der Bruchkante und beuge mich nach unten. Dann packe ich ihr Handgelenk und führe es zur Seite, zu einer Bohle, die einigermaßen tragfähig aussieht. Gleichzeitig versuche ich, die schwimmenden Latten beiseite zu räumen, damit sie besser auftauchen kann. Ein großes Stück Holz erfordert meine gesamte Kraft und so reagiere ich nicht schnell genug, als die Planken unter mir ein bedrohliches Knarren von sich geben, so wie die Stützbalken alter Silberminen in Westernstreifen, kurz bevor die ganze Hütte zusammenkracht. Im nächsten Augenblick geben die heimtückischen Mistviecher auch schon unter mir nach. Zumindest habe ich noch die Genugtuung, in Moniques gerade auftauchendes Antlitz zu blicken, bevor die Wasser über mir zusammenschlagen.
Ich stürze kopfüber in die salzige Brühe. Wasser dringt in meinen Mund. Ich drehe mich, versuche, wieder hoch zu kommen, aber es fühlt sich entsetzlich falsch an. Irgendwo muss doch die Wasseroberfläche †¦ - plötzlich treten meine Füße Luft. Wieso versuche ich, in die Tiefe zu tauchen? Ich habe mich doch †¦ - alles ist irgendwie verdreht. Meine Orientierung und mein Körpergefühl liegen irgendwo auf dem Meeresgrund. Dort betreiben sie gemeinsam mit meiner Atmung vermutlich gerade fröhliches Komasaufen. Ich drehe mich noch einmal, und endlich - Luft.
Greller Sonnenschein strahlt mir ins Gesicht, während ich gierig frischen Sauerstoff in meine gepeinigte Lunge sauge. Aber wo zur Hölle bin ich? Als ich mich umsehe, sehe ich nichts. Nur Wasser, unendlich viel Wasser. Endlos folgt blaue Welle auf blaue Welle bis zum Horizont. Über mir - Azur. Ein Himmel so klar und strahlend rein wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ein Universum von Blau. Azur und Saphir. Noch halte ich mich gut über Wasser, lasse mich von den Wellen auf und ab tragen. Der Seegang ist zwar durchaus fordernd, aber kein Lüftchen weht und so sind die Wellen, dafür, dass ich draußen auf dem Ozean bin, relativ flach. Draußen auf dem Ozean! Allein!
Diese Erkenntnis lässt mein Herz schneller schlagen. Welche unendlichen Tiefen lauern unter mir und was lebt dort? Haie? Wenn jetzt zufällig einer in meine Nähe - Verdammt, wie bin ich hierher gekommen? Und wo sind die anderen? Hektisch spähe ich in alle Richtungen, aber da ist kein Schiff. Nicht einmal ein Stück Treibgut, oder eine Möwe, als weißer Punkt in der blauen Weite. Direkt über mir brennt der Sonnengott seinen gleißenden Stempel ins Firmament, zu vollkommen, um ihm ins Gesicht zu sehen. Und ich bin immer noch allein. Ich habe keine Orientierungspunkte. Unablässig wirft mich der Atem der See hoch und nieder. Wellenkamm, Wellental. Vorwärts. Rückwärts. Ohne Ziel. Ich gleite. Und doch bedarf es jedes Mal ein wenig mehr Anstrengung, dabei kein Wasser zu schlucken. Was tue ich nur? Ich kann das nicht ewig durchhalten, irgendwann wird mir die Kraft ausgehen. Aber wohin soll ich schwimmen, da ist gar nichts, bis zum Horizont, ungebrochene Größe. Die Weite lässt mich schaudern, und vor meinen Augen verschwimmen Himmel und Meer zu einer Einheit, bis die Ferne in erdrückende Nähe rückt. Alles ist unendlich. Und meine Arme werden schwer. Vor mir, unerreichbar nah, schweben die nächsten Wellen heran und wenn sie mich erfassen, werden sie schon vergangen sein, ersetzt durch tausend Geschwister. Ich kann sie nicht festhalten, also fange ich an zu schwimmen. Irgendwas muss ich doch tun! Da muss doch irgendwo etwas sein! Selbst für eine verbeulte Coladose oder ein Stück Plastik wäre ich jetzt dankbar. Etwas, das mir beweist, dass es außer mir noch Leben gibt. Doch nichts. Nur Blau. Blau und eine höhnische Sonne, die meine Schultern und meinen Nacken versengt. Ich schwimme fieberhaft. Weiter und weiter, bis mir Waden und Schultern schmerzen. Auf und ab drängt es mich. Auf und Ab. Der Raum hat sich nicht verändert. Ich pflüge durch ein endloses Nichts. Da. Auf einmal höre ich ein seltsames Geräusch. Ich brauche eine Weile, um zu begreifen, dass es meine eigene Stimme ist, und dass ich mich in meiner Verzweiflung heiser schreie. Aber bevor ich um meine Stimmbänder fürchten muss, schlucke ich jede Menge Salzwasser. Als ich mich wieder gefangen habe, spüre ich das dumpfe Ziehen in den Gliedern noch stärker als zuvor. Ich halte mein Tempo nicht mehr durch, habe Seitenstechen. Aber die See kennt keine Gnade. Auf und ab. Auf und ab. Und ich muss schwimmen. Chancenlos. Meine Augen tränen vom Salz, meine Lippen brennen, und meine Hände kann ich kaum noch spüren, da trägt es mich wieder auf den Kamm hinauf. Jäh gleitet ein Schatten über die Sonne. Unmerklich dunkelt das Blau der Fluten, wird tiefer und finsterer, als plötzlich in der Ferne eine Bewegung die Wasserdecke hebt. Ich kneife die Lider zusammen und versuche, näheres zu erkennen, da scheucht mich die nächste Welle wieder ins Tal. Ich versinke im Blau. Als ich wieder auftauche, ist das Fremde noch da. Jetzt näher, deutlich kann ich den Wellenberg sehen, unter dem es dahin rast, bevor die Wellen mich wieder hinab ziehen.
Es kommt direkt auf mich zu!
Und wieder bin ich unten. Was kann es sein? Es sah groß aus. Meine nächste Chance kommt und ich finde es erneut. Es muss ein Tier sein, das da auf mich zuschießt. Irgendetwas Schmales ragt wie eine Antenne aus dem Wasser. Nein! Keine Antenne. Eine Rückenflosse. Was mache ich jetzt? Ein Delphin wäre toll. Immerhin retten die Menschen. Sagt man. Aber es ist für einen Delphin zu groß, fürchte ich, also ist es etwa doch etwas Blutrünstiges? Fressen Haie nun Menschen? Da ist es wieder! Es ist schon viel näher, die trennenden Wellenberge schrumpfen. Oder ist das nur eine Erfindung der Filmindustrie? Hoffentlich. Ich blute ja auch nicht, oder waren die Piranhas die mit dem Blut? Die mit dem Blut? Weiter schießt es auf mich zu und plötzlich denke ich: Torpedo! Aber wo soll der herkommen? Macht hier ein U-Boot eine Übung? Vielleicht haften sich die Dinger an alles, was sich bewegt. Gleich ist es da. Ich muss weg! Schwimmen, schwimmen! Aber es ist ja doch schneller. Viel schneller. Die Wellen bäumen sich auf, die Flut gerät in Wallung und ich, mittendrin, werde gegen die nächste aufgetürmte Woge geworfen. Dann erhebt sich die See vor mir wie eine schillernde Wand. Tsunami! Meterhoch. Haushoch. Turmhoch. Will sie den Himmel durchstoßen? Doch, was ist das? Hinter dem Wellenvorhang eine Gestalt, ein Koloss. Gigantisch. Seltsam erhaben. Ich kann den Umriss mächtiger Schultern erkennen, eines Kopfes mit wallendem Haupthaar und den Schatten einer riesigen Waffe, in einer unendlich mächtigen Faust. Ein Dreizack †¦ Kann das wahr sein? Der Gott der Meere? Poseidon?
„DU WAGST ES?“, dröhnt eine Stimme in meinem Kopf, die mich zum Zittern bringt und mich innerlich erfrieren lässt.
„DU KEHRST ZURÜCK!“ Ich bin wie gelähmt, kann mich kaum rühren, und warum ich noch Luft bekomme, weiß ich nicht. Erst als ich an mir hinabblicke, wird mir das unfassliche klar. Ich stehe auf einem Wirbel von tiefdunklen Wassern. Auf dem Kamm einer Säule, die aus unendlichen Tiefen hinauf ragt, über mir droht die titanische Gestalt. Wieder sprudelt die Stimme in meinem Schädel über.
„DIESMAL, GÖTTERLÄSTERER, IST DIR MEIN ZORN GEWISS!“
Aber ich war doch noch gar nicht hier! Und wo sind wir überhaupt? Leider kann ich nichts antworten, meine Stimme gehorcht mir nicht. Der Dreizack hebt sich, sticht durch den Vorhang, und tut einen einzigen Schlag. Dann schleudert mich die Säule gen Himmel, bevor sie als Strudel in dunkle Tiefen zurücksinkt, dabei alles mitreißend. Ich fliege. Ich falle. Der Aufschlag. Als ob mein Rücken zerplatzt.
Ich finde mich wieder in einer aufgebrachten See und kämpfe gegen den Sog der Tiefe. Einmal gelingt es mir, für einen Augenblick Luft zu schnappen, da prallt mir das Gorgonenhaupt gegen die Brust. Wieso trage ich es plötzlich wie eine Kette um den Hals?
Die Frage verliert aber ziemlich an Bedeutung angesichts der Tatsache, dass sich das Amulett bewegt, als lebte es. Die Schlangenhaare zucken vor meinen Augen, und plötzlich löst sich ein Reptil. Schon schlüpft es ins Wasser. Windet sich. Und wächst. Als mich der Sog wieder hinab ziehen will, umschlingt ein kühler Leib meinen linken Arm und zerrt mich brutal hinauf an die Wasseroberfläche. Aus der Flut erhebt sich ein Schlangenhaupt, etwa so groß wie mein eigener dummer Kopf. Um die kleinen Schlangenaugen wachsen Federn aus dem schuppigen Leib, erinnern an eine Eule. Was ist das für ein Vieh? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Schlange? Eule? Habe ich darüber nicht schon mal etwas gehört?
Der Schlangenleib packt mich fester und will mich mitziehen. Doch er kämpft mit den Wellen, so wie ich. Oder reißt mich das Tier bewusst hinab? Ich vermag es nicht zu sagen. Schon kommt die nächste Angriffsflut, die uns ins dunkle Grab saugen will.
Ich halte mich mehr schlecht als recht über Wasser, während die Schlange den Großteil der Wellenwucht abfängt. Dadurch lockert sich ihr Griff, und gibt mir den Raum, um für kurze Zeit selbst zu schwimmen und mich neu zu orientieren. Und was sehe ich da? Scheinbar schwerelos trabt auf der Gischt tatsächlich ein weißes Pferd heran. Eine goldene Aureole schillert um das weiße Fell, als habe die Sonne selbst dieses anmutige Wesen geküsst. Weiße, gefiederte Flügel recken sich wie ein angelisches Schutzversprechen vom Widerrist. Kommt es etwa, mich zu retten? Es trabt auf mich zu. Irgendwie scheint mir auch das Pferd vertraut, und ein Teil von mir erinnert sich, dass da etwas war. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe ein paar Sekunden, in denen ich mich von der Schlange losreißen und die letzten Meter zu dem Flügelpferd schwimmen könnte. Oder ich vertraue der Schlange mit dem seltsamen Gefieder.
Stimmen, ratet mir gut, was soll ich jetzt tun?
Sagen Sie unserem Helden bis zum 31.12.2008, 23:59 Uhr, was er tun soll, und zwar hier.
- Fortsetzung folgt.-
Die Corona-Kurzgeschichte
Liebe Kurzgeschichten-Freunde,
es hat sich angeboten, auch in der Weihnachtsausgabe des Corona Magazines eine Kurzgeschichte unterzubringen - wenn man eine Geschichte wie „Besuch am Heiligen Abend“ von Regina Schleheck vorliegen hat. Die beschert allen Lesern hoffentlich einen vergnüglichen Vorgeschmack auf Weihnachten. Wie immer freuen sich Autorin und Redaktion über Rückmeldungen - sei im Forum oder per Leserbrief.
Die nächsten Themen des Corona-Kurzgeschichtenwettbewerbs lauten: „Das Ende der Welt“ (Einsendeschluss 1. Januar 2009), „Transit“ (Einsendeschluss 1. Februar 2009), „Metamorphose“ (Einsendeschluss 1. April 2009) „Hinter dem Spiegel“ (Einsendeschluss 1. Juni 2009), „Labyrinth“ (Einsendeschluss 1. Oktober 2009) und „Exil“ (Einsendeschluss 1. Dezember 2009). Wer Interesse hat, sich mit einer Kurzgeschichte (Science Fiction, Fantasy, Horror, Phantastik - keine Fan-Fiction) zu beteiligen, die einen Umfang von 20.000 Zeichen nicht überschreitet, schickt seine Story (möglichst als rtf-Datei) rechtzeitig per E-Mail an die Kurzgeschichten-Redaktion, die unter kurzgeschichte@corona-magazine.de zu erreichen ist. Die nach Meinung der Jury drei besten Geschichten werden wie immer im Corona Magazine veröffentlicht.
Armin Rößler
Besuch am heiligen Abend
von Regina Schleheck
Die Straße glänzte tiefschwarz, nur an den Stellen, an denen sich der Regen zu großen Pfützen zusammengefunden hatte, um anderntags die Messegänger über spiegelglatte Eisflächen schlingern zu lassen, da schillerte es in allen Farben. Während der Drogist, das Schild an der Ladentür wendete, fiel der Widerschein der gespiegelten Weihnachtsbeleuchtung auf sein Gesicht und ließ es grün und rot aufleuchten. Er hielt einen Moment inne und starrte nachdenklich nach draußen, wo die Menschen mit ihren letzten Weihnachtseinkäufen hastig unter großen Schirmen zu ihren Heimstätten flohen.
Es war ein windiger Abend, geradezu stürmisch, ja, man hörte in der Ferne von Zeit zu Zeit etwas heulen, dass es den Drogisten fröstelte, während er da stand und hinausstarrte.
Die Lichterkränze an den Fenstern gegenüber wechselten die Farbe im immergleichen Rhythmus: grün - rot - gelb - blau, und die Nase des Drogisten leuchtete im gleichen Rhythmus grün - rot - gelb - blau, dann legte sich die Farbe als Rahmen um sein Gesicht und breitete sich weiter über das Glas der Tür aus, während die nächste Farbe auf der Nasenspitze des Drogisten aufglühte.
Erst als der Körper des Drogisten sich schon zum Gehen gewendet hatte, löste sich sein Blick von der dunklen Straße. Er ging zum Tresen, um den abendlichen Kassensturz zu machen, und der träumerische Ausdruck in seinen Augen verschwand, als hätte es ihn nie gegeben.
Er hatte vergessen, die Tür abzuschließen, und so öffnete sie sich noch einmal mit schrillem Klingeln, als der Drogist gerade mitten im Zählen war. Er machte eine abwehrende Bewegung mit der einen Hand zur Tür hin, während sein Blick gebannt an den Scheinen hing, die er mit der anderen Hand abzählte.
„Tut mir leid, der Laden ist schon geschlossen.“
Aber der Eindringling blieb einfach stehen. Es war eine große untersetzte Gestalt in rotem Kapuzenmantel und schwarzen schweren Stiefeln: der Weihnachtsmann! Der Mantel hing ihm dunkel und nass am Leib und tropfte kleine Rinnsale auf das Linoleum vor der Tür. Der ganze Weihnachtsmann bot ein Bild des Jammers. Der Drogist hatte verärgert aufgeblickt. Als er jedoch sah, wen er vor sich hatte, zuckte er zusammen und schmolz förmlich vor Bedauern dahin.
„Nein, das ist ja - Himmel, der Weihnachtsmann persönlich! Wie konnte ich nur - ja, guter Mann, wie sehen Sie denn aus? Sie hat es aber bös erwischt! Sie sind ja ganz blass, mein Gott, die Nase läuft und ganz rote Augen haben Sie!“, stammelte er.
Er legte die Scheine in die Kasse zurück und fegte das bereits gezählte Geld achtlos dazu in die Lade, die er mit einem Ruck schloss, um dem Weihnachtsmann mit geöffneten Armen ein paar Schritte entgegenzueilen. Der nasse rote Mann hob abwehrend beide Hände.
„Nicht doch, ich wollte Sie doch gar nicht aufhalten - es ist nur -“, er drehte mit den Fingern an dem Stoffsaum seiner Ärmel. „Es ist nur - normalerweise erscheine ich den Menschen ja nicht, aber Sie sehen ja selbst - ich bin am Ende meiner Kräfte.“
„Oh ja, oh ja, das sehe ich“, sagte der Drogist mitfühlend. Er machte eine Geste, als wollte er dem Weihnachtsmann seinen nassen Mantel abnehmen, zögerte dann aber, rieb die Hände verlegen ineinander und redete weiter drauflos: „Mein Gott, Sie Ärmster, Sie! Das ist aber doch auch kein Wunder bei dem Sauwetter da draußen! Da möchte man ja keinen Hund vor die Tür jagen! - Und Sie müssen immer - das ist weiß Gott kein leichter Job! - Ich bewundere Sie ja! - Schon als kleiner Junge hab ich mich immer schon gefragt: †™Wie macht der das bloß? In einer einzigen Nacht, das ist ja eine Ochsentour, und das, ob†™s stürmt oder schneit!†™“
Der Weihnachtsmann schien selbst sehr ergriffen. Eine einzelne Träne lief ihm aus dem roten Auge über die Wange und tropfte auf seine nasse breite Brust.
„Ja, ja, so ist das, Jahr für Jahr - aber manchmal kann selbst ich dann einfach nicht mehr, und da kam ich gerade hier vorbei, und da wollte ich Sie um Hilfe bitten -“
Der Drogist ermannte sich. „Das war recht so“, sagte er mit fester Stimme. „Hier wird Ihnen Hilfe zuteil! Nehmen Sie das hier erst mal!“
Er griff ein Päckchen Papiertaschentücher aus dem Regal, riss es auf und bot dem Weihnachtsmann davon an.
Der Weihnachtsmann zog ein Tuch aus der angebotenen Packung heraus, entfaltete es mit blinzelnden Augen und schnäuzte sich trompetend hinein.
„Danke, vielen Dank!“, nuschelte er in das Tuch.
Der Drogist stopfte ihm das angebrochene Päckchen fürsorglich in die Manteltasche und ging dann sinnend an ihm vorbei die Regale entlang, während er vor sich hin sprach:
„Mein Gott, was hab ich denn da? Was könnte ich Ihnen anbieten? - Pastillen, Lutschbonbons, Inhalationstropfen, Erkältungstee - “, er griff dabei in die Regale und fischte einige Päckchen heraus.
Der Weihnachtsmann sah zweifelnd auf die Produkte, die der Drogist in der linken Hand anhäufte.
„Sie meinen wirklich, das hilft? - Wissen Sie, ich fühle mich einfach so leer, völlig ausgepumpt - “
Der Drogist war voller Verständnis.
„Uns Menschen geht es doch nicht anders. Gerade zu dieser Zeit und im Einzelhandel - “
Aber der Weihnachtsmann unterbrach ihn unwirsch.
„Ja, ja, natürlich, wir tragen alle unser Päckchen. Und es wird jedes Jahr schlimmer! Diese Massenschlachtungen der Tannenwälder! Trotz des Baumsterbens! Der Konsumterror der Überflussgesellschaft, die total verwöhnten und dabei doch sozial verwahrlosten Kinder! - Da könnten einem weiß Gott die Tränen kommen.“
Der Drogist ereiferte sich: „Sie sprechen mir ja so was von der Seele! Das Fest der Freude ist nicht mehr das, was es mal war!“
Das kurze Auflachen des Weihnachtsmannes hatte einen schrillen Unterton.
„Fest der Freude, sagen Sie? - Das reinste Trauerspiel ist es! Aber je schlimmer die Menschen es treiben, umso weniger kann ich dabei empfinden. Manchmal überkommt es mich so, dass ich vor lauter Verzweiflung nur noch lachen kann, wo ich doch eigentlich in Tränen ausbrechen müsste!“
Der Drogist bot ihm spontan das Päckchen Tempotücher wieder an, als hätte er nicht recht verstanden, was der Mann im roten Mantel gesagt hatte.
„Ich weiß, es ist unprofessionell“, ereiferte sich dieser, die Geste seines Gegenübers ignorierend. „Aber ich kann einfach nicht mehr! Ich hab schon so oft überlegt, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, aber - wozu sollte ich dann noch gut sein?“
Der Drogist war ein Bild der Bestürzung. „Nein, nein, so dürfen Sie doch nicht reden!“
„So ist es aber, und gerade als ich eben wieder so weit war, sah ich Ihren Laden und dachte, hier könnte mir vielleicht geholfen werden!“ Der Weihnachtsmann sah den Mann im weißen Kittel forschend an, und dieser verbeugte sich tief.
„Es ist mir eine große Ehre!“
Der Blick des Weihnachtsmannes fiel auf das Regal hinter dem Rücken des vornüber gebeugten Drogisten. „Da! - Das ist es doch! Das ist es, was ich suche!“ Er griff mit einer raschen Handbewegung in das Regal und hätte dem Drogisten dabei fast einen Kinnhaken verpasst, als dieser sich aufrichtete.
„Weingummi!“, frohlockte der Weihnachtsmann, „das ist es doch, was ich brauche!“
Der Drogist blickte ihn entgeistert an.
„Weingummi?“, fragte er verwirrt.
Der Weihnachtsmann strahlte. „Das hilft doch bestimmt!“ Er fing den Blick seines Gegenübers auf und stutzte. „Sie meinen, es hilft nicht? Aber es heißt doch Weingummi! - Was soll ich denn bloß machen? Ich dachte doch, hier finde ich ganz bestimmt was, das mich zum Weinen bringt!“
„Wieso denn zum Weinen?“, fragte der Drogist verblüfft.
Das Entsetzen des Weihnachtsmannes war nicht minder. „Aber ist das denn hier keine Drogerie? Ich dachte, Sie verkaufen hier Drogen! Irgendwas, das einen so richtig runterzieht!“
„Ich dachte, Sie brauchten etwas gegen Ihre Erkältung!“, entgegnete der Drogist verblüfft.
„Aber ich bin doch der Weinnachtsmann!“, gab der rot gewandete Himmelsbote verzweifelt zurück. „Weinnachtsmänner müssen weinen, die ganze Weinnacht lang, sonst sind sie keine Weinnachtsmänner mehr, sondern genauso überflüssig wie der ganze Tanderadei, den die Menschen um die Weinnacht veranstalten! - Gott, es ist zum Heulen!“
Er schluchzte jetzt in höchster Verzweiflung auf, und siehe da, die Tränen begannen wieder aus seinen Augen zu fließen, sie fielen in wahren Sturzbächen rechts und links über seine Wangen, suchten sich ihren Weg durch die salzigen Furchen, die ihre Vorgänger im Antlitz des Weihnachtsmannes hinterlassen hatten, versickerten in dem dichten Bart, der sich immer voller sog, bis sich an der Spitze ein kleines Tröpfchen formte, das fiel, dicht gefolgt von weiteren Tränen, die unaufhörlich nachdrängelten. Der Mann weinte herzzerreißend. Er jaulte und schluchzte in höchsten Tönen. Seine Augen glitzerten und er packte mit beiden Händen die Hände des Drogisten und schüttelte sie kräftig.
„Danke“, schluchzte er begeistert. „Vielen, vielen Dank!“
Dann wandte er sich entschlossen zur Tür, öffnete sie energisch, und mit schrillem Klingeln schritt er hinaus in das bunte Lichtergefunkel, das das Abenddunkel durchschnitt und entschwand rasch aus dem Blickfeld des erstarrten Drogisten. Nur sein Schluchzen war noch eine Weile zu hören, das immer leiser wurde, bis es nicht mehr zu vernehmen war.
Der Drogist stand noch lange nachdenklich in seinem Laden vor seiner Kasse, das angebrochene Päckchen Tempotücher in der Hand und sann nach. Dann rieb er sich die Augen wie nach einem schweren Traum.
„Nein, das kann ich keinem weiter erzählen. Das kann nicht sein. Sollten wir uns alle so getäuscht haben? - Nein, ich muss das geträumt haben. Ich bin einfach ein bisschen müde, das ist es.“
Er ließ seine Kasse wieder aufschnappen und begann bedächtig, von Neuem seine Einnahmen zu zählen.
Irgendwo in der Ferne heulte ein Dezembersturm.
Regina Schleheck
Seit fast einem halben Jahrhundert auf diesem Planeten, vor allem in Köln, Aachen, Herford, jetzt Leverkusen unterwegs. Seit einem Vierteljahrhundert am Eigen-Art-Erhalt arbeitend, fünffach erfolgreich. Beruflich Lehr. Seit fast einer Dekade gelegentlich schreibend. Zuletzt eineinzweiundfünzigstelfach mit dem Deutschen Phantastik Preis versehen.

Corona Breaking News: Star Trek und mehr
Erstellt von
Mike Hillenbrand
, Dez 23 2008 01:27
Keine Antworten in diesem Thema
#1
Geschrieben 23 Dezember 2008 - 01:27
www.ifub-verlag.de - der Verlag in Farbe und Bunt
www.trekminds.info - Was die Welt (und Dirk) von Star Trek lernen kann
www.corona-magazine.de - Phantastik-Magazin seit 1997
www.trekminds.info - Was die Welt (und Dirk) von Star Trek lernen kann
www.corona-magazine.de - Phantastik-Magazin seit 1997
Besucher die dieses Thema lesen: 0
Mitglieder: 0, Gäste: 0, unsichtbare Mitglieder: 0